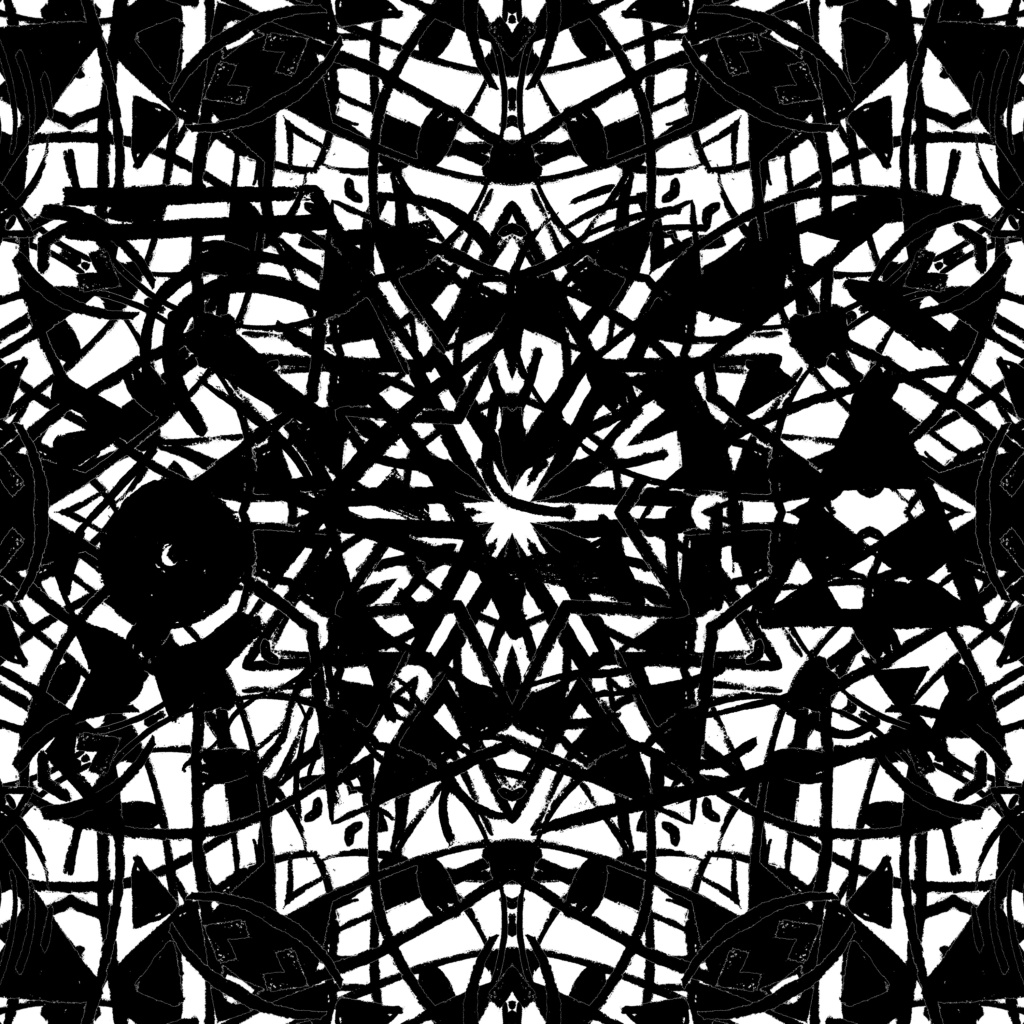Wir stehen im Dunkeln und schneiden Fratzen, die niemand sehen kann. Angewidert starren wir uns an, wohl wissend, dass wir blind sind.
Doch wir können uns fühlen, hören, riechen. Ein ganzer Raum voller Wesen, in Schatten gehüllt.
„Bis zum Ende aller Zeiten“ flüstert eine Stimme aus der Dunkelheit und wir werden niemals wissen, wer das gesagt hat. Genauso wenig, wie wir jemals das kaum hörbare Weinen aus der anderen Richtung zuordnen können werden.
Licht existiert nicht, existierte nie.
Aufgewachsen in einem Raum aus Finsternis, jeder einzelnen von uns, vermissen wir das Licht auch nicht. Wir hatten nie gelernt, wie es sich anfühlt, wenn jemand unsere schmerzverzehrten Gesichter sieht, Mitleid empfindet, oder auch nur Ekel, irgendetwas, alles besser als dieses Nichtvorhandensein von Gefühl, diese Leere, die uns alle quält, Tag für Tag, Nacht für Nacht, Jahr um Jahr.
Die Dunkelheit um uns herum kroch auch in unsere Herzen, legte sich wie ein Schatten über unsere Liebe, jeden Tag ein wenig mehr. Also waren unsere Herzen einst lichtvoll? Musste das Licht aus ihnen vertrieben werden? Wo ging es hin? Wir konnten es nicht sehen. Nicht einmal erahnen. Und sofern wir nicht von außen beobachtet wurden, konnte es niemand sehen. Niemand wissen. Niemand bezweifeln.
Niemals war in unseren Herzen auch nur ein Fünkchen Licht gewesen, flüsterten wir uns gegenseitig zu, bis wir es glaubten. Doch ich weiß es genau, ich erinnere mich an etwas, es war nicht immer so finster.
Ich erinnere mich an einen Schimmer, bunt schillerndes Eis auf wogenden Wellen. Woher sollte ich dieses Bild kennen, wenn es denn nicht direkt aus meinem Herzen stammte?
Doch war das wirklich wichtig? Es gibt keinen Ausweg. Uns fehlte nicht nur der Schlüssel zu einer Tür, die uns ins Licht führen sollte, uns fehlte die Tür selbst.
Leises Wehklagen tönt aus einer Richtung und ich fühle den kalten Lufthauch des Todes in dieselbe Richtung huschen. Wieder kehrt Stille ein und wir alle wissen: Wir werden immer weniger. Weniger Seelen, die auf ihren Richtspruch warten. Wann ist es so weit?
„Wann ist es so weit?“ wiederholt eine zarte Stimme zaghaft neben mir meine Gedanken, als würde sie sie selbst erleben.
„Wann ist es so weit?“ höre ich nun auch jemanden von weiter weg fragen, bestimmter, als wäre die Frage an mich gerichtet.
Doch woher sollte ich das wissen? Bin ich doch unwissend. So wie alle anderen auch. Oder?
„Wann ist es so weit?“ fragt nun jemand laut in den Raum und ich fühle, wie mich blinde Augen anstarren.
„Ich weiß es nicht“ flüstere ich, zaghaft, leise. Zu leise.
„Wann ist es so weit?“ schreit jemand und noch jemand und noch jemand, mit einem Mal der ganze Raum, unzählige Stimmen erheben sich zu einer einzigen.
Jahrhunderte lang war Stille und tonloses Leiden alles, was diesen Raum ausmachte, doch an diesem Tage nahm der Lärm überhand.
Ich muss mir die Ohren zuhalten, musste es tun. Werde mir die Ohren zuhalten. Eines Tages.
Kann den Lärm nicht ertragen. Kann die Vorwürfe nicht ertragen. Kann den Schmerz in meinem Kopf nicht überleben.
„Ich weiß es nicht“ wimmere ich, während ich, die Hände auf meine vermutlich blutenden Ohren gedrückt, zu Boden sinke, die Stirn auf den kalten Stein presse und anfange laut zu schluchzen. Ich weiß es doch nicht. Ich wusste es nie. Niemals würde ich es wissen. Kann nichts wissen. Will nichts wissen. Wünschte ich wäre nicht nur blind. Sondern auch taub. Und stumm. Ohne Empfindungen. Tot.
Wir lebten nicht in Dunkelheit. Wir lebten in den Schatten, die unsere Herzen warfen, getaucht in bunt schillerndes Sonnenlicht.
Mein Gesicht verzerrt sich zu einer völlig neuen Fratze, als ich den kalten Hauch des Todes über meinen Körper streifen fühle, lieblos, liebevoll, achtlos, bewundernd, verurteilend, vergebend.
Mein Gesicht erstarrte und mein Sterben beantwortete die Frage, die all den anderen Fratzen so wichtig gewesen war.
Jetzt ist es so weit.
Wir leben nicht in Dunkelheit. Doch wir sterben in Dunkelheit.